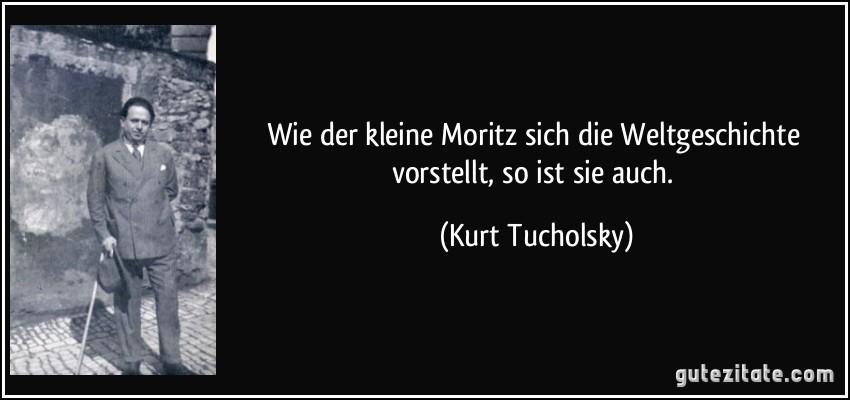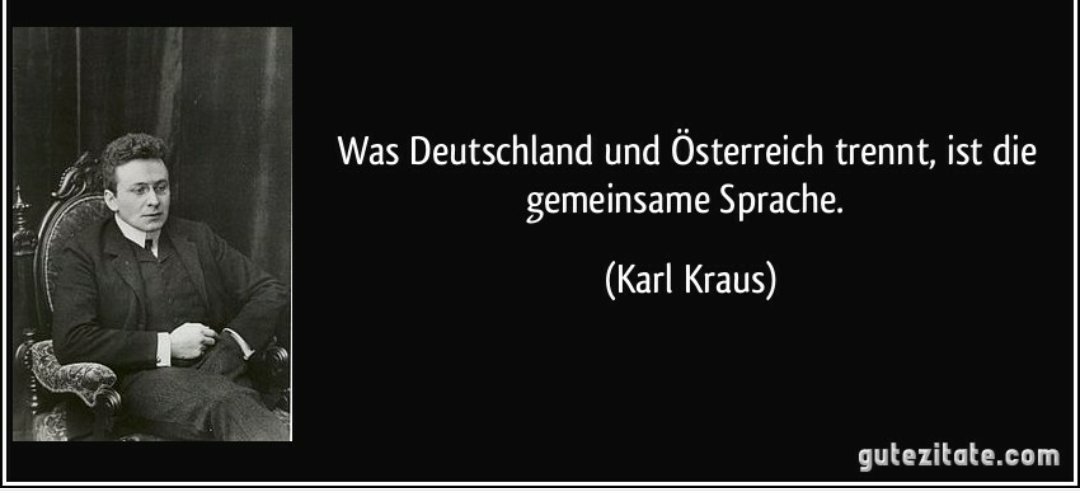|
| Pseudo-Aristoteles-Zitat. |
- "Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes, wenn einmal unsere heutige Jugend die Männer von morgen stellt. Unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen."
- "Unsere Jugend ist unerträglich,
unverantwortlich und entsetzlich anzusehen. Wenn ich die junge
Generation anschaue, verzweifle ich an der Zukunft der Zivilisation.
Aristoteles, um 350 v. Chr." (Link)
 |
| Pseudo-Hesiod-Zitat? |
- "I see no hope for the future of our people if they are to be dependent upon the frivolous youth of today for certainly all the youth are reckless beyond words and opinionated much beyond their years. When I was a boy we ... Hesiod" (Link)
"Nine hundred years before Christ, a Greek social critic had this to say,
- "I see no hope for the future of our people if they are to be dependent upon the frivolous youth of today. and certainly our youth are reckless beyond words, and opinionated much beyond their years." (Link)
- 'I see no hope for the future of our people if they are dependent on the frivolous youth of today, for certainly all youth are reckless beyond words.'" In: "The Redbook report on female sexuality: 100,000 married women disclose the good news about sex." (Link)
- "In the third century B.C., Socrates said: I see no hope for the future ..... When I was a boy, we were taught to be discreet and ..." In: "Tell me it's only a phase!: a guide for parents of teenagers." (Link)
Der
Autor Maletzke war von Beruf weder Altphilologe noch Philosoph: Er ist also
keine vertrauenswürdige Quelle für ein neu aufgefundenes Aristoteles-Zitat, das in keiner seriösen
Zitatesammlung vorkommt und in Amerika Hesiod zugeschrieben wird.
Im 21. Jahrhundert wird dieses
Pseudo-Aristoteles-Zitat von Ratgeber-Autorinnen, Pädagogen, Technikern, Psychiatern,
Ökonomen und Juristinnen auch auf Deutsch weiter verbreitet. Zwei Beispiele: Robert
Feuerhake: "Synthese und Strukturaufklärung neuer Heterodimetallkomplexe
des Niob" (2004) (Link) oder Jutta Hofmann u. Susanne Helb: "Erfolg im Job mit Stil u. Intuition" (2007) (Link).
Schließlich
wurde dieses angeblich klassische Lamento über die Jugend in viele Zitat-Sammlungen
aufgenommen: zum Beispiel in das Buch "Zitate im Management: Das Beste
von Top-Performern und Genies aus 2000 Jahren Weltwirtschaft" (Link) oder in die Anekdotenanthologie: "Die passende Anekdote zu jedem Anlass. Witzig und geistreich. Für Reden, Small Talk und vieles mehr" (2010). (Link) Leider hat auch ein Philosoph (Günther Friesinger (Link)) diesen
Satz zitiert. Ich hätte sonst geschrieben, dass nur Fachfremde,
die den nüchternen, trockenen Sound von Aristoteles' Prosa nicht im Ohr
haben, auf so ein typisches Zivilisationsuntergangs-Jammer-Zitat hereinfallen können.
Da
ich nicht der Einzige bin, der diesen Satz in keinem Text von
Aristoteles weder so noch so ähnlich gefunden hat - auch Wikipedia-Autoren zum Beispiel haben vergeblich
danach gesucht (Link) -, kann man davon ausgehen, dass das Zitat nicht von Aristoteles stammt, noch dazu, wenn man die 120 jährige Geschichte dieses Zitats bedenkt. –
Ob das Zitat jemals in einem Text Hesiods gefunden werden wird, weiss ich nicht. (Link).
In den sieben Jahrzehnten, in denen das Zitat bei Tausenden Jugendkritikern populär wurde, hat nicht eine einzige Person eine griechische Quelle dafür
angeben können, was für ein Klassiker-Zitat recht ungewöhnlich ist.
Meine These: Ein deutscher Autor hat sich 1988 in der Zuschreibung an Aristoteles geirrt: der Rest plappert tausendfach gedankenlos nach, was in unseriösen Zitat-Lexika geschrieben steht.
Artikel in Arbeit.
ZITATFORSCHUNG unterstützen.
________
Ich danke Lisi Moosmann für den Hinweis auf Hesiod und Moritz Jacob für seine Recherchen zur Geschichte der Hesiod-Zuschreibung.
Letzte Änderung: 24. August 2020